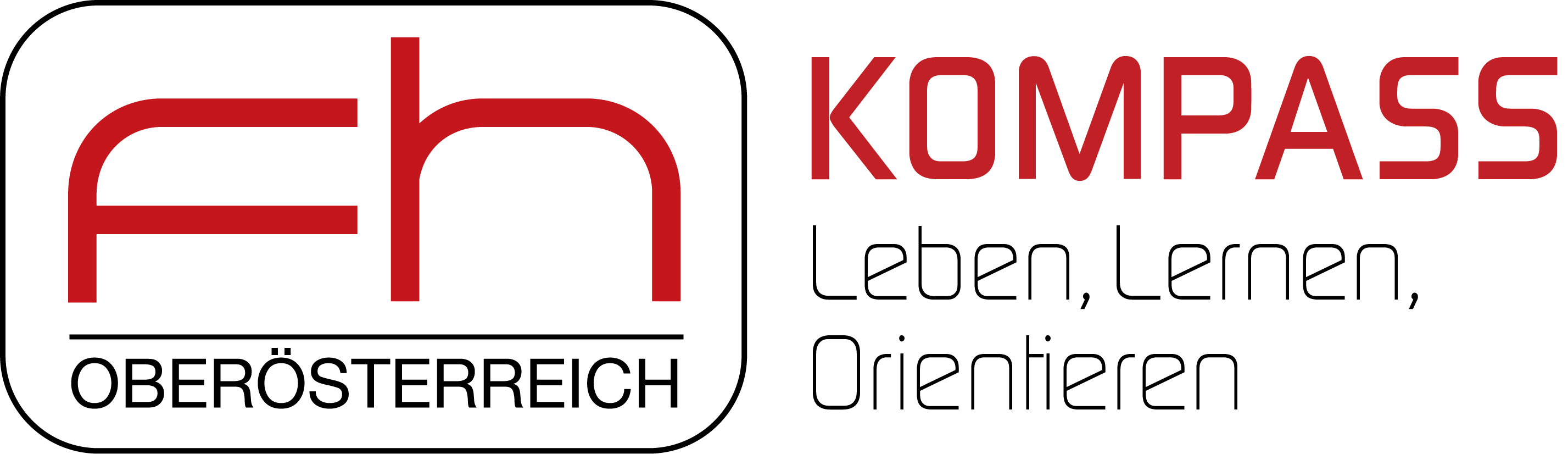RESSOURCEN ZUR ERKENNUNG VON SUCHT UND DROGENkonsum
Was ist Sucht?
Eine psychische oder physische Abhängigkeit von einer Substanz oder von einem bestimmten Verhaltens wird als Sucht bezeichnet. Es definiert somit keine Charakterschwäche, sondern eine Krankheit. Betroffene verspüren einen starken Zwang oder Wunsch, eine Substanz zu konsumieren oder eine bestimmte Handlung auszuführen. Sucht ist immer eine psychische Abhängigkeit. Eine körperliche Abhängigkeit kann gegeben sein, diese ist jedoch abhängig von der jeweiligen Substanz, die eine betroffene Person zu sich nimmt.

Wie erkenne ich Sucht?
Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird von Sucht oder Abhängigkeit gesprochen, wenn über einem Zeitraum von einem Jahr mindestens drei der folgenden Kriterien aufgetreten sind:
-
- Starker Wunsch oder Zwang zur Einnahme einer Substanz und Beschaffung eben dieser
- Steigerung des Konsums bzw. Verhaltens, um die gewünschte Wirkung zu erzielen (Toleranzerhöhung oder -bildung)
- Verminderte Kontrollfähigkeit und gänzlicher Verlust der Kontrolle über das eigene Verhalten, vor allem in Bezug auf Beginn, Beendigung und Menge des Konsums
- Psychische und physische Entzugserscheinungen bei Reduktion oder Beendigung des Konsums bzw. des Verhaltens
- Fortsetzung des Konsums trotz Wissens um die eigene (dauerhafte) Schädigung und auch jener aus dem Umfeld
- Rückzug aus dem sozialen Leben und fortschreitende Vernachlässigung von Verpflichtungen und Interessen
Sucht entsteht – in den meisten Fällen – über einen längeren Zeitraum und kommt oftmals schleichend. Der Übergang in die Abhängigkeit ist somit sowohl für Betroffene als auch für Angehörige häufig schwer erkennbar.
Wie kann ich einer suchtkranken Person helfen?

- Das Suchtproblem benennen
- Zugangshürden einbauen
- Eine Grenze setzen und aufrechterhalten
- Sucht ist Sucht, Sucht ist eine Krankheit
- Suchtverhalten offen ansprechen und um Hilfe bitten
Auch wenn suchtkranke Menschen darüber scherzen, oder im Umfeld ein lockerer Umgang mit Suchtmitteln üblich ist: eine Abhängigkeit ist eine Abhängigkeit und sollte, wenn möglich, auch gegenüber den suchtkranken Angehörigen so benannt werden.
Wenn suchtkranke Menschen die Einkäufe ihrer Suchtmittel selbst erledigen und bezahlen müssen, ist dies ungleich mühsamer, als wenn z.B. jederzeit eine Flasche Alkohol von Verwandten zur Verfügung gestellt, oder zum Geburtstag das nächste Computerspiel geschenkt wird.
Alltagsverpflichtungen, alltägliche Belastungen, negative Folgen des Suchtverhaltens im sozialen Leben müssen von den Betroffenen selbst erlebt und bewältigt werden, damit sie sich im Falle des Falles für eine Behandlung entscheiden können. Wenn Angehörige stets die negativen Seiten des Suchtverhaltens übernehmen, kann bei Betroffenen das Gefühl entstehen, dass das eigene Verhalten eigentlich gar nicht so schlimm ist.
Dies ist eine Tatsache und bedarf keiner Entschuldigungen oder Rechtfertigungen durch Angehörige.
Freund*innen, Nachbar*innen, Verwandte, Bekannte sind Unterstützer*innen im Kampf gegen die Sucht. Die Einschätzung des Problems von Außenstehenden wird in der Regel ernster genommen als von der Familie oder den besten Freund*innen.
Es ist wichtig, dass sich suchtkranke Personen mit ihrem eigenen Suchtverhalten und den Folgen auseinandersetzen und sich dem Problem “stellen”. Angehörige haben oft den Wunsch, das Suchtverhalten der betroffenen Person kontrollieren zu können. Dies ist jedoch nicht möglich, jeder Mensch kann nur sein eigenes Verhalten steuern.
Was kann ich als Angehörige*r tun?
Das Leben vieler Angehöriger kreist um das Suchtproblem der Betroffenen. In der folgenden Podcastfolge kannst du mehr darüber erfahren, wie Angehörige Warnsignale erkennen kann und mit der süchtigen Person umgehen können.
Folgende Tipps können dir helfen, gut auf dich zu achten:
- Schau auf deine eigene Gesundheit und gönn dir z.B. Rückzugsorte und -zeiten.
- Führe ein eigenständiges Leben, nimm deine eigenen Alltagsverpflichtungen wahr und pflegen deine sozialen Kontakte.
- Achte auf deine eigenen Grenzen. Frage dich, was für dich noch zu tolerieren ist und was nicht. Therapeutische Maßnahmen sollten immer von ausgebildeten Therapeut*innen gesetzt werden, nicht von Familienmitgliedern.
- Suche dir Hilfe: Es ist ok, alleine nicht weiter zu wissen. Professionelle Unterstützung kann dir gut tun.
- Du kannst dein eigenes Verhalten und deinen Umgang mit suchtkranken Angehörigen steuern, nicht jedoch das anderer Menschen.
Kontaktstellen
Abhängigkeitserkrankungen – Anton Proksch Institut
Alle Anlaufstellen –
Need Some Help
Anonyme Alkoholiker
(A.A.) Österreich und Südtirol
Handreichung der FH OÖ
Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums
ÖH FH OÖ Student Helpline
Österreichischer Suchthilfekompass
Pro Mente – Sucht
Psychologische Studierendenberatung
Sucht und Drogenkoordination Land OÖ
Substanz – Verein für suchtbegleitende Hilfe
Diversity Talk: Sucht
Der 26. Diversity Talk der FH wird zum Thema Sucht von Mag. Michael Silly von ProMente abgehalten.
Praktische Tipps, wie sich Angehörige, Freund*innen, Bekannte oder Kolleg*innen im Falle einer Suchterkrankung einer nahestehenden Person verhalten können werden ebenso thematisiert wie allgemeines Wissen zum Thema Sucht und Abhängigkeit.
Let's Talk About It: Genuss, Gewohnheit oder schon abhängig?
Mag. Michael Silly von der pro mente Suchtberatung wird mit uns in diesem Let’s talk about it-Termin über Suchtmittel sprechen: über illegalisierte Substanzen, aber auch Verhaltenssüchte wie Computerspielabhängigkeit. Wann ist ein Konsum oder Verhalten noch im Rahmen? Wie kann ich erkennen, dass ich oder Freund*innen, Kolleg*innen oder Verwandte abhängig sind? Was kann ich tun? Auch das Thema K.O.-Tropfen wird adressiert.
Du möchtest uns etwas sagen bzw. mit uns in Kontakt treten? Wir freuen uns auf deine Meinung!
Du kannst uns (Kompass-Team) gerne anonym oder persönlich eine Nachricht zukommen lassen.
-
- Wenn du uns anonym etwas schreiben möchtest, tippe nur die Nachricht ein und sende diese.
- Falls du eine persönliche Frage hast und eine Antwort möchtest, gib bitte auch deine E-Mail-Adresse an.